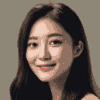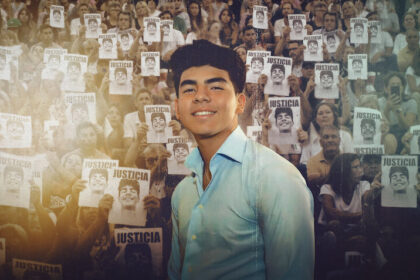Die neue südkoreanische Serie Aema ist weltweit auf der Streaming-Plattform Netflix gestartet und präsentiert ein historisches Comedy-Drama, das in eine der turbulentesten und widersprüchlichsten Perioden der modernen Kulturgeschichte des Landes eintaucht. Die sechsteilige Serie spielt im Herzen der koreanischen Filmindustrie, bekannt als Chungmuro, in den frühen 1980er Jahren und konstruiert eine fiktionalisierte Erzählung um die Produktion eines realen und historisch bedeutsamen Films: des erotischen Spielfilms Madame Aema von 1982. Dieser Film war ein Kassenschlager, der einen Boom des erotischen Kinos einleitete, ein Genre, das einen Großteil der populären Filmproduktion des Jahrzehnts bestimmen sollte. Die Serie nutzt dieses historische Ereignis jedoch nicht als Thema einer Filmbiografie, sondern als Katalysator, um die systemischen Zwänge, die Geschlechterpolitik und die künstlerischen Kompromisse zu untersuchen, die das Filmemachen unter einem autoritären Regime prägten. Die Handlung wird von den sich kreuzenden Wegen zweier Frauen an entgegengesetzten Enden des beruflichen Spektrums angetrieben. Jung Hee-ran, dargestellt von Lee Hanee, ist eine etablierte, preisgekrönte Schauspielerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, die jedoch darum kämpft, ihr öffentliches Image neu zu definieren und dem Typecasting zu entkommen, das ihr Ruhm einbrachte. Ihr gegenüber steht Shin Joo-ae, eine ehrgeizige Newcomerin, gespielt von Bang Hyo-rin, die die Serie als Stepptänzerin in einem Nachtclub mit dem Traum vom Ruhm beginnt. Der zentrale Konflikt entzündet sich, als Hee-ran in einem entscheidenden Akt beruflicher Selbsterhaltung die Hauptrolle in Madame Aema ablehnt, nachdem sie ein Drehbuch voller, wie sie es nennt, exzessiver und grundloser Nacktszenen gelesen hat. Diese Ablehnung schafft ein Vakuum, das die opportunistische Joo-ae eifrig füllt, die Rolle gewinnt und die Bühne für eine komplexe berufliche Rivalität bereitet. Diese Dynamik entfaltet sich in einer von Männern dominierten Branche, in der die Handlungsfähigkeit von Frauen ständig in Frage gestellt wird, und legt von Anfang an das thematische Kerngebiet der Serie fest. Die Einstufung der Serie als Comedy-Drama ist ein entscheidender Indikator für ihre tonale und intellektuelle Strategie. Anstatt ihr ernstes Thema mit reiner Feierlichkeit anzugehen, setzt Aema komödiantische und satirische Elemente ein, um die Absurditäten der Machtstrukturen und gesellschaftlichen Sitten der Ära zu sezieren und das Werk als anspruchsvollen kritischen Kommentar statt als geradliniges historisches Melodram zu positionieren.

Die paradoxe Landschaft von Chungmuro in den 1980er Jahren
Um den narrativen Druck, der die Charaktere in Aema formt, vollständig zu verstehen, muss man die einzigartige und zutiefst paradoxe soziopolitische Landschaft Südkoreas in den frühen 1980er Jahren begreifen. Die Serie spielt während des autoritären Militärregimes von Präsident Chun Doo-hwan, dessen Herrschaft von 1980 bis 1988 als eine der dunkelsten Perioden der modernen Geschichte des Landes in Erinnerung geblieben ist, eine Ära intensiver politischer Unterdrückung und eingeschränkter bürgerlicher Freiheiten. In filmischen Darstellungen wird diese Zeit fast ausnahmslos mit einer düsteren visuellen Palette dargestellt, die durch gedämpfte Farben und schwere Schatten gekennzeichnet ist und die bedrückende nationale Stimmung widerspiegelt, wie in Filmen wie 12.12: The Day und 1987: When the Day Comes zu sehen ist. Die Chun-Regierung, die versuchte, den öffentlichen Dissens zu unterdrücken und die Aufmerksamkeit von ihren politischen Aktivitäten abzulenken, implementierte die sogenannte „3S-Politik“: eine staatlich geförderte Förderung von Screen (Kino), Sex (Erotik in der Populärkultur) und Sports (Sport). Obwohl es einige historische Debatten über die formale Kodifizierung dieser Politik gibt, stellt die Serie sie als ein kalkuliertes Instrument der politischen Befriedung dar, das darauf abzielt, den Massen Unterhaltung und Ablenkungsmöglichkeiten zu bieten. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie war die aktive Förderung der Erotikfilmindustrie. Die Aufhebung einer 36-jährigen landesweiten Ausgangssperre im Jahr 1982 schuf einen neuen Markt für nächtliche Unterhaltung und führte zum Aufstieg der „Mitternachtsfilme“, von denen Madame Aema der erste und explosivste Erfolg war. Diese staatlich sanktionierte Förderung sexueller Inhalte ging jedoch mit einer ebenso mächtigen und widersprüchlichen Kraft einher: einem strengen und oft willkürlichen System staatlicher Zensur. Filmemacher befanden sich in einem volatilen und schizophrenen kreativen Umfeld. Sie wurden durch Regierungspolitik und Marktnachfrage gedrängt, sexuell explizite Inhalte zu produzieren, waren aber gleichzeitig den unvorhersehbaren Launen der Zensoren ausgesetzt, die Kürzungen oder Änderungen verlangen konnten und ihnen damit faktisch die Meinungsfreiheit nahmen. Dieser grundlegende Widerspruch ist in Aema nicht nur ein historischer Hintergrund; er fungiert als Hauptantrieb der Erzählung. Die äußeren Zwänge, die die Charaktere treffen – von den unerbittlichen Forderungen des Produzenten nach Nacktheit, um kommerzielle Erwartungen zu erfüllen, über den Wunsch des Regisseurs, inmitten des krassen Kommerzes Kunst zu schaffen, bis hin zu den Kämpfen der Schauspieler mit ausbeuterischen Szenen – sind alles direkte Folgen dieser paradoxen Staatspolitik. Die Serie postuliert, dass in dieser Ära das persönliche und berufliche Leben von Künstlern untrennbar mit den politischen Machenschaften eines autoritären Staates verbunden war und so einen Mikrokosmos der breiteren gesellschaftlichen Spannungen der Zeit schuf.
Eine Erzählung von Rivalität und Solidarität
Der dramatische Kern von Aema liegt in der komplexen, sich entwickelnden Beziehung zwischen den beiden weiblichen Protagonistinnen, deren persönliche und berufliche Reisen als kraftvolle Linse dienen, durch die die Serie die Geschlechterpolitik des koreanischen Kinos der 1980er Jahre untersucht. Die Erzählung zeichnet ihre Dynamik akribisch nach, wie sie sich von einer scharfkantigen Rivalität in eine widerstandsfähige und bedeutungsvolle Allianz verwandelt. Jung Hee-rans Charakterbogen ist einer des Widerstands und der Rückeroberung. Dargestellt von Lee Hanee, ist sie ein Topstar, der ihre Karriere auf den populären „Hostessenfilmen“ der 1970er Jahre aufgebaut hat, Filmen, die oft Barmädchen und Prostituierte zeigten und ihr Image als Sexsymbol festigten. Nun, an einem entscheidenden Punkt ihrer Karriere, ist sie entschlossen, diese Persona hinter sich zu lassen und allein für ihr schauspielerisches Talent anerkannt zu werden. Ihre Ablehnung der Hauptrolle in Madame Aema ist kein Akt der Prüderie, sondern eine kalkulierte berufliche Selbstbestimmung, ein Standpunkt gegen weitere Typisierung und Ausbeutung. Dieser Akt des Trotzes gewährt ihr jedoch keine Freiheit. Sie ist vertraglich an den Filmproduzenten, den abscheulichen und manipulativen Gu Joog-ho (Jin Seon-kyu), gebunden, der eine Lücke in ihrem Vertrag nutzt, um sie in eine demütigende Nebenrolle in genau dem Film zu zwingen, den sie abgelehnt hat. Dies zwingt sie, die Produktion aus einer kompromittierten Position heraus zu navigieren, was in Momenten explosiver Konfrontation gipfelt, einschließlich einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Produzenten und dem trotzigen Versprechen: „Joong-ho, lass uns zur Hölle fahren“. Im krassen Gegensatz dazu ist Shin Joo-aes Bogen ein Bildungsroman von Ehrgeiz und Ernüchterung. Gespielt von der Newcomerin Bang Hyo-rin, ist Joo-ae ein Charakter rohen Ehrgeizes, eine Stepptänzerin, die die vakante Hauptrolle in Madame Aema als einmalige Gelegenheit betrachtet. Sie erklärt kühn ihre Absicht, „die nächste Jeong Hee-ran“ zu werden, und signalisiert damit ihren Wunsch, ihr Idol zu verdrängen. Anfangs ist sie bereit, alles zu tun, um erfolgreich zu sein, einschließlich der Erfüllung der ausbeuterischen Forderungen der Branche. Doch im Laufe der Produktion werden ihre Illusionen systematisch zerstört. Sie wird mit der Realität ihrer Rolle konfrontiert, gezwungen, „sinnlose explizite Szenen“ aufzuführen, die von Produzenten und Zensoren diktiert werden, und erlebt aus erster Hand die allgegenwärtige Frauenfeindlichkeit der Branche. Ihre Reise ist schmerzhaft, aber transformativ und führt sie von naivem Ehrgeiz zu einem entwickelten kritischen Bewusstsein über das System, das sie zu erobern suchte.
Anfangs ist die Beziehung zwischen den beiden Frauen von Reibung geprägt. Hee-ran, unsicher darüber, ins Abseits gedrängt zu werden, und nachtragend gegenüber ihrer Nachfolgerin, macht der Newcomerin am Set das Leben schwer. Doch als sie beide die Machenschaften der Männer an der Macht ertragen, schmiedet ihre gemeinsame Erfahrung systemischer Unterdrückung eine unwahrscheinliche Verbindung. Ihre Rivalität weicht langsam einer „sanften Solidarität“. Sie erkennen, dass ihr wahrer Feind nicht sie gegenseitig sind, sondern das patriarchale System, das sie um Macht- und Respektkrümel gegeneinander ausspielt. Diese Entwicklung von Antagonistinnen zu Verbündeten, vereint in dem gemeinsamen Entschluss, sich gegen Ausbeutung zu wehren, bildet das emotionale und thematische Herz der Serie. Diese Reise wird von den Handlungen der männlichen Charaktere umrahmt, die die korrumpierenden Kräfte der Branche repräsentieren. Gu Joog-ho, der CEO von Shinsung Films, ist die Verkörperung des zynischen Kommerzes. Beschrieben als „zwielichtiger Produzent“, der „vor nichts zurückschrecken würde, um zu überleben“ in der wettbewerbsorientierten Welt von Chungmuro, betrachtet er seine Schauspieler als Ware und Kunst als ein zu verkaufendes Produkt. Sein Gegenpol ist der Nachwuchsregisseur Kwak In-woo (Cho Hyun-chul). Charakterisiert als „schüchtern“, „ungeschickt“ und „zaghaft“, ist In-woo ein aufstrebender Künstler, der einen Film mit „subtiler Erotik“ machen möchte, sich aber zwischen seiner eigenen kreativen Vision und dem unerbittlichen Ruf des Produzenten nach „endlosen Busen“ gefangen findet. Er repräsentiert den kompromittierten Künstler, der darum kämpft, seine Integrität in einem auf Ausbeutung ausgerichteten System zu bewahren. Die Serie verwendet eine ausgeklügelte Erzählstruktur, in der der Film-im-Film zu einem potenten Metakommentar über weibliche Handlungsfähigkeit wird. Die Kämpfe der Charaktere in Madame Aema auf der Leinwand spiegeln direkt die Kämpfe der Schauspielerinnen wider, die sie abseits der Leinwand führen. Wie eine Analyse feststellt: „Durch den Filmprozess verwandelt, wird das sexuelle Verlangen der Protagonistinnen von Madame Aema auf der Leinwand zum Verlangen nach Handlungsfähigkeit der Schauspielerinnen, die sie darstellen.“ Hee-rans Kampf gegen Nacktszenen und Joo-aes Unbehagen mit grundlosem Inhalt sind nicht nur Handlungspunkte; sie sind thematische Argumente über die Kontrolle und Objektivierung des weiblichen Körpers sowohl im Kino als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen. Darüber hinaus trifft die Serie eine subversive strukturelle Entscheidung in der Zuweisung des Tons. Die primäre dramatische Erzählung – die komplexe emotionale Reise von Rivalität zu Solidarität angesichts systemischen Missbrauchs – wird fast ausschließlich von den beiden weiblichen Hauptfiguren getragen. Im Gegensatz dazu sind die männlichen Darsteller größtenteils für die komödiantischen Elemente verantwortlich, die oft aus ihrer Grobheit und der peinlichen Komik beim Regieführen und Drehen der erotischen Szenen entstehen. Indem die männlichen Autoritätsfiguren zu den primären Objekten der Satire und die weiblichen Figuren zu den Subjekten eines ernsten, fesselnden Dramas gemacht werden, kehrt die Serie subtil die traditionellen narrativen Machtdynamiken um, stellt die weibliche Erfahrung in den Mittelpunkt und nutzt Humor, um die Grundlagen des patriarchalen Systems zu kritisieren.
Die autorenhafte Vision von Lee Hae-young
Aema markiert das Fernsehdebüt des Drehbuchautors und Regisseurs Lee Hae-young, dessen etabliertes Werk im Kino einen klaren Kontext für die stilistischen und thematischen Ambitionen der Serie liefert. Eine Untersuchung seiner Filmografie offenbart einen Autoren mit einer unverwechselbaren Stimme, die sich durch Genrefluidität, eine verfeinerte visuelle Sensibilität und eine konsequente Beschäftigung mit Charakteren auszeichnet, die sich in unterdrückerischen sozialen Strukturen bewegen. Seine früheren Filme umfassten mehrere Genres, von der Kriminal-Action von Believer (2018) und dem Spionagethriller Phantom (2023) bis zum Mystery-Horror von The Silenced (2015) und den Komödien Foxy Festival (2010) und Like a Virgin (2006). Über diese vielfältigen Projekte hinweg wurde seine Arbeit für ihre „frische Erzählweise“, „sensible und subtile Regie“ und eine anspruchsvolle Mise-en-Scène gelobt, die starke Action mit sehr ausgeprägten Charakterisierungen verbindet. Die thematischen Anliegen von Aema sind in Lees Werk nicht neu. Sein jüngster Film, Phantom, in dem ebenfalls Lee Hanee mitspielte, wurde für seinen Fokus auf die „Solidarität von Frauen in einer erstickend patriarchalen Gesellschaft“ bekannt, ein Thema, das auch in dieser neuen Serie zentral ist. In diesem Sinne kann Aema als Fortsetzung und Erweiterung seiner künstlerischen Interessen gesehen werden, bei der er seine filmischen Sensibilitäten auf das episodische Format des Fernsehens anwendet. Die vielleicht auffälligste autorenhafte Handschrift in Aema ist seine bewusste und stark stilisierte visuelle Ästhetik. Die Serie lehnt bewusst die konventionelle visuelle Sprache ab, die zur Darstellung der Ära von Chun Doo-hwan verwendet wird. Anstelle der erwarteten „gedämpften Paletten“ und „dicken Schatten“, die politische Unterdrückung signalisieren, konstruiert Lee Hae-young die 1980er Jahre als eine „hinreißende“ und „üppige“ Welt, ein „Sammelsurium kaleidoskopischer Farben und fabelhafter Mode“. Dies ist kein Akt nostalgischer Romantisierung, sondern eine kalkulierte kritische Strategie. Der Regisseur selbst hat die Absicht hinter dieser Wahl artikuliert und erklärt, dass je „blendender die Klänge und Bilder an der Oberfläche erscheinen, desto deutlicher würde die Gewalt dieser barbarischen Zeit als Botschaft durchkommen“. Diese ästhetische Wahl fungiert als eine Form des historischen Revisionismus. Sie argumentiert visuell, dass die Brutalität der Ära nicht nur eine Frage offener politischer Unterdrückung war, sondern auch durch die grelle, ablenkende Oberfläche einer staatlich geförderten Massenunterhaltungskultur verdeckt wurde. Die lebendige Ästhetik zwingt den Betrachter, sich der tiefen Dissonanz zwischen der aufkeimenden, farbenfrohen Kulturindustrie und der düsteren politischen Realität, die sie verschleiern sollte, zu stellen. Diese visuelle Strategie lässt die zugrunde liegende Unterdrückung heimtückischer erscheinen und hebt die Heuchelei im Herzen der 3S-Politik hervor.
Die Serie kommt auch als Teil eines größeren Gesprächs innerhalb des zeitgenössischen südkoreanischen Kinos. Sie teilt bemerkenswerte stilistische und thematische DNA mit anderen neueren Filmen, die die filmische Vergangenheit der Nation neu untersuchen. Ihre Prämisse weist eine starke Ähnlichkeit mit Kim Jee-woons Cobweb (2023) auf, einer Meta-Komödie und liebevollen Farce, die die Egos und Unsicherheiten einer Filmcrew in den 1970er Jahren satirisiert. Mit einer Film-im-Film-Struktur folgt Cobweb einem frustrierten Regisseur, der gegen Studiobosse und Regierungszensoren kämpft, während er versucht, das Ende seines Films neu zu drehen. Darüber hinaus erinnern Aemas visueller Glanz und die Besetzung von Lee Hanee in einer Rolle, die weibliche Archetypen dekonstruiert, an Lee Won-suks Kultfilm Killing Romance (2023). Diese absurde musikalische schwarze Komödie nutzte ebenfalls einen lebendigen, surrealistischen Stil und eine düster-komische Handlung, um Themen der Befreiung einer Frau von einem missbräuchlichen, kontrollierenden Mann zu erforschen und gleichzeitig die Promi-Kultur zu kritisieren. Das Aufkommen dieser Filme deutet darauf hin, dass Aema kein isoliertes Werk ist, sondern ein wichtiger Beitrag zu einem sich entwickelnden Subgenre selbstreflexiver Historienfilme. Diese Bewegung sieht zeitgenössische koreanische Filmemacher in einem kritischen Dialog mit ihrer eigenen nationalen und filmischen Geschichte, wobei sie die Werkzeuge von Genre, Stil und Meta-Erzählung nutzen, um die Traumata und Widersprüche der Vergangenheit aus einer modernen Perspektive neu zu befragen.
Eine fiktive Linse auf die historische Wahrheit
Obwohl Aema tief in einem spezifischen historischen Moment verwurzelt ist, ist es entscheidend, ihre Beziehung zu den Fakten zu verstehen. Die Serie ist ein Werk der historischen Fiktion, kein Dokumentarfilm oder Biopic. Der Film Madame Aema von 1982 war ein reales und massiv einflussreiches kulturelles Phänomen, das die Kinokassen anführte und ein Dutzend direkte Fortsetzungen sowie zahlreiche andere Ableger hervorbrachte. Die Charaktere, die die Serie bevölkern – von den Schauspielerinnen Jung Hee-ran und Shin Joo-ae bis zum Produzenten Gu Joog-ho und dem Regisseur Kwak In-woo – sind jedoch vollständig fiktive Schöpfungen. Regisseur Lee Hae-young hat zugegeben, sich von den dokumentierten Erfahrungen von Schauspielerinnen aus dieser Ära inspirieren zu lassen, insbesondere von An So-young, dem Star des ursprünglichen Madame Aema, aber die Erzählung hält sich nicht an die spezifischen Ereignisse im Leben einer einzelnen Person. Diese bewusste Fiktionalisierung ist eine strategische Entscheidung, die es der Serie ermöglicht, eine tiefere und umfassendere thematische Agenda zu verfolgen. Indem archetypische Charaktere geschaffen werden, anstatt durch biografische Treue eingeschränkt zu sein, kann die Erzählung freier als breiterer sozialer Kommentar fungieren. Sie kann die systemischen Probleme von Frauenfeindlichkeit, Zensur, künstlerischem Kompromiss und unternehmerischer Ausbeutung, die damals in der Branche endemisch waren, effektiver untersuchen. Die Charaktere werden zu Repräsentanten der verschiedenen wirkenden Kräfte, was eine fokussiertere Untersuchung der Machtdynamiken der Ära ermöglicht.
Die Beteiligung der Produktionsfirma The Lamp Co., Ltd., die die Serie gemeinsam mit Studio Kik Co., Ltd. produzierte, verleiht diesem Ansatz erhebliches Gewicht. The Lamp Co. hat sich einen beeindruckenden Ruf für die Produktion von von der Kritik gefeierten und kommerziell erfolgreichen Filmen erarbeitet, die akribisch recherchiert sind und auf wahren historischen Ereignissen basieren. Ihre Filmografie umfasst so wegweisende Titel wie A Taxi Driver (2017), der den Gwangju-Aufstand dramatisierte; Mal-Mo-E: The Secret Mission (2019), über die Bewahrung der koreanischen Sprache unter japanischer Kolonialherrschaft; Samjin Company English Class (2020), basierend auf einem echten Unternehmensskandal; und Phantom (2023), ein Spionagethriller, ebenfalls unter der Regie von Lee Hae-young und mit Lee Hanee in der Hauptrolle. Die Verbindung eines Produktionshauses, das für sein Engagement für historische Authentizität bekannt ist, mit einem Projekt, das explizit fiktiv ist, ist eine bedeutende kreative Entscheidung. Sie deutet auf die Überzeugung hin, dass in diesem Fall eine fiktive Erzählung ein wirksameres Mittel ist, um die emotionale und systemische Wahrheit der 1980er Jahre zu vermitteln, als es eine streng faktenbasierte Nacherzählung sein könnte. Sie signalisiert dem Publikum, dass die Geschichte zwar nicht buchstäblich wahr ist, aber als historische Interpretation ernst genommen werden soll, die die lebendigen, komödiantischen und dramatischen Elemente der Serie mit einem Unterton journalistischer und historischer Integrität ausbalanciert. Letztendlich präsentiert sich Aema als eine komplexe moderne Neubetrachtung eines entscheidenden und kontroversen Moments in der koreanischen Kulturgeschichte. Sie nutzt ihren fiktiven Rahmen und eine ausgeprägte autorenhafte Vision, um dauerhafte Themen wie weibliche Solidarität, den Preis künstlerischer Integrität und die komplizierte, oft gefährliche Beziehung zwischen Kunst, Kommerz und Politik zu erforschen.
Die sechsteilige Serie Aema ist ab sofort weltweit zum Streamen verfügbar und feierte am 22. August 2025 auf Netflix Premiere.