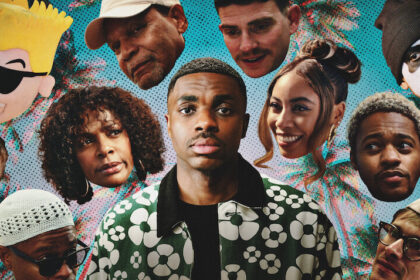Wir sind es gewohnt, dass True Crime eine Autopsie der Vergangenheit ist. Wir sehen abgeschlossene Fälle, Forensiker, die kalte Beweise analysieren, und wir atmen aus sicherer zeitlicher Distanz auf. Aber was passiert, wenn das Verbrechen kein vergangenes Ereignis ist, sondern ein live übertragenes Spektakel? Was passiert, wenn eine Tragödie zu Inhalt wird und eine Geiselverhandlung der Tyrannei der Einschaltquoten unterworfen wird?
Eine neue Netflix-Dokumentation mit dem Titel „Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel“ taucht in die Archive eines der düstersten und medienwirksamsten Momente der jüngeren Geschichte Brasiliens ein. Die Produktion blickt zurück auf die Entführung, die „Brasilien lähmte“, ein herzzerreißender Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt, der aus einem erschreckenden Grund außer Kontrolle geriet: Die ganze Nation sah zu. Die Dokumentation ist nicht nur die Rekonstruktion eines Verbrechens; sie ist die Autopsie eines Medienzirkus und eines institutionellen Versagens, das sich in Echtzeit vor Millionen von Menschen abspielte.
Die Wohnung
Der Schauplatz war eine gewöhnliche Wohnung in einer Wohnsiedlung in Santo André, São Paulo. An einem ganz normalen Nachmittag machte die 15-jährige Eloá Pimentel mit drei Freunden Schularbeiten. Bei ihr waren ihre Freundin Nayara Rodrigues da Silva, ebenfalls 15, und zwei Mitschüler, Iago Vilera und Victor Campos.
Die Normalität wurde durchbrochen, als Lindemberg Alves, 22 Jahre alt und Eloás Ex-Freund, in die Wohnung eindrang. Er war mit einer Pistole bewaffnet. Das Motiv war ebenso tragisch wie gewöhnlich: Er „akzeptierte das Ende der Beziehung nicht“.
Kurz nach seinem Eindringen ließ Alves die beiden Jungen, Iago und Victor, frei. Aber er hielt Eloá und ihre Freundin Nayara als Geiseln. So begann eine Belagerung, die als die längste Geiselnahme im Bundesstaat São Paulo in die Geschichte eingehen sollte: eine schreckliche Zerreißprobe, die über hundert Stunden dauerte. Hundert Stunden, in denen ein Verbrechen im häuslichen Umfeld zu einem nationalen Spektakel wurde.
„Wir sind auf Sendung“: Wenn die Presse zur Protagonistin wird
Diese hundert Stunden waren der perfekte Nährboden für die Katastrophe. Was eine von der Polizei kontrollierte Krisenzone hätte sein sollen, wurde zu einem Open-Air-Fernsehstudio. Die Szene war ein Chaos aus „Presse, Polizei, viel Hektik“. Die Geiselnahme wurde „fast in Echtzeit im Fernsehen übertragen“, und wie zu erwarten war, waren die Einschaltquoten „für alle extrem hoch“.
Die Grenze zwischen Beobachten und Teilnehmen löste sich fast sofort auf. Mehrere Fernsehsender bekamen die Telefonnummer der Wohnung. Die Moderatorin Sônia Abrão von RedeTV! rief an und führte ein Live-Interview mit Lindemberg, dem Geiselnehmer. Zeugen beschrieben die Szene als „schockierend“: eine Fernsehberühmtheit, die live mit dem Kriminellen sprach, während dieser zwei Teenager mit einer Waffe bedrohte. Jahre später erklärte Abrão, sie bereue nichts und „würde es wieder tun“.
Sie war nicht die Einzige. In der Morgensendung „Hoje em Dia“ auf Record hatte die Moderatorin Ana Hickmann eine Idee: Sie schlug live vor, der Geiselnehmer oder die Opfer sollten ein „Zeichen am Fenster“ geben, um „zu zeigen, dass alles in Ordnung ist“ und die Öffentlichkeit zu beruhigen. Ihr Co-Moderator, Britto Jr., unterstützte den Vorschlag und nannte ihn „gut“.
Diese mediale Hektik hatte direkte und katastrophale Folgen. Der Geiselnehmer konnte vom Inneren der Wohnung aus alles, was draußen geschah, auf seinem eigenen Fernseher verfolgen, einschließlich der Strategie und Positionierung der Polizei. Ein Staatsanwalt in dem Fall erklärte, dass eine Moderatorin, indem sie die Rolle der Unterhändlerin übernahm, „die Verhandlungen behinderte“. Der Kriminelle wurde, weit davon entfernt, isoliert zu sein, so „berühmt“, dass er sich „wie ein Star fühlte“. Währenddessen versammelten sich Hunderte von Menschen auf der Straße. Einige „nutzten sogar die Anwesenheit der Kameras, um zu versuchen, ins Fernsehen zu kommen“. Es war offiziell eine Reality-Show.
Der unbegreifliche Fehler
Während der Medienzirkus tobte, ereignete sich ein schwerwiegendes Versagen bei den Polizeiverfahren. Der Einsatz der Spezialeinheit GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) der Polizei von São Paulo war geprägt von dem, was als „flagrante Fehler“ bezeichnet wurde.
Der schwerwiegendste und vielleicht unbegreiflichste Fehler betraf Nayara Rodrigues. Nachdem sie von Lindemberg freigelassen worden war und sich bereits in Sicherheit befand, traf die Polizei eine unerklärliche Entscheidung: Sie baten sie, in die Wohnung zurückzukehren.
Ein Beamter ging zu Nayaras Haus, um sie zu bitten, „bei den Verhandlungen zu helfen“. Der Einsatzleiter, Oberst Flávio Depieri, genehmigte die Rückkehr der 15-Jährigen in die Gefangenschaft. Ein ehemaliger nationaler Sekretär für öffentliche Sicherheit bezeichnete diese Entscheidung später als kapitalen Fehler. Die Polizei schickte in dem Versuch, eine Krise zu lösen, die sie nicht mehr unter Kontrolle hatte, eine minderjährige Zivilistin zurück ins Kreuzfeuer. Jahre später stufte die Justiz diese Handlung als einen der „Fehler des Polizeieinsatzes“ ein und verurteilte den Staat zu einer Entschädigungszahlung an Nayara.
Das Finale
Der Dampfkochtopf, angeheizt durch hundert Stunden gescheiterter Verhandlungen, medialer Einmischung und „total katastrophaler“ Polizeitaktiken, explodierte schließlich. Die Polizei beschloss, die Wohnung zu stürmen.
Die Aussage von Nayara, der Überlebenden, ist entscheidend. Sie sagte aus, dass sie Schüsse hörte, bevor es der Polizei gelang, einzudringen. Ihrer Schilderung zufolge zerrte Lindemberg einen Tisch vor die Tür, um sie zu blockieren; sie bedeckte sich mit einer Decke, und dann hörte sie drei Schüsse. Unmittelbar danach brach die Polizei die Tür auf.
Während des Zugriffs schoss Lindemberg auf beide jungen Frauen. Sie wurden beide als Notfall ins Krankenhaus gebracht. Nayara überlebte trotz ihrer Verletzungen. Eloá Pimentel nicht; sie wurde für „hirntot“ erklärt.
Das Leben danach
In den folgenden Jahren schlugen die an der Tragödie Beteiligten unterschiedliche Wege ein.
Lindemberg Alves wurde vor Gericht gestellt und wegen 12 Verbrechen schuldig gesprochen. Er wurde verurteilt (die Quellen schwanken zwischen 39 und 98 Jahren Haft) und in die Justizvollzugsanstalt Tremembé in São Paulo gebracht. Kürzlich erhielt er die Einstufung in den „halboffenen Vollzug“. Berichte über seine Zeit im Gefängnis beschreiben ihn als „Studenten“, der ein „vorbildliches Verhalten“ an den Tag legt.
Nayara Rodrigues hingegen wählte den entgegengesetzten Weg. Heute führt sie ein „zurückgezogenes Leben“. Sie studierte Ingenieurwissenschaften und vermeidet es aktiv, Interviews über das Trauma zu geben, das sie erlebt hat. Die öffentliche Beobachtung hat sie jedoch nicht losgelassen. Im Zuge der Ankündigung der neuen Dokumentation stellte Eloás Schwägerin, Cíntia Pimentel, öffentlich die Freundschaft zwischen den beiden jungen Frauen in Frage („Waren sie wirklich so gute Freundinnen?“), und wies darauf hin, dass Nayara „die Familie nach der Tragödie nie wieder kontaktiert hat“. Der Kommentar löste eine neue Kontroverse aus und zwang Psychologen, sich in die öffentliche Debatte einzuschalten, um zu erklären, dass Nayaras Reaktion mit dem „Überlebenden-Syndrom“ (Schuldgefühle des Überlebenden) oder einer „Dissoziation“, einem Abwehrmechanismus angesichts eines extremen Traumas, vereinbar ist.
Was die Dokumentation (endlich) enthüllt
Der Dokumentarfilm, bei dem Cris Ghattas Regie führte und der von Paris Entretenimento produziert wurde, kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: Der Täter genießt Hafterleichterungen, während die Überlebende weiterhin öffentlich verurteilt wird. Seine Relevanz liegt genau in dem Material, das er ans Licht bringt.
Während dieser hundert Stunden waren die Stimmen, die die Übertragung dominierten, die des Geiselnehmers, der Fernsehmoderatoren und der Polizeisprecher. Eloás Stimme ging im Lärm unter.
Diese neue Produktion präsentiert zum ersten Mal „nie zuvor veröffentlichte Auszüge aus dem Tagebuch der jugendlichen Eloá Pimentel“. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, sie bietet die Zeugenaussagen von Menschen, die „zum ersten Mal öffentlich über das Verbrechen sprechen“: ihr Bruder Douglas Pimentel und ihre Freundin Grazieli Oliveira. Der Film interviewt auch Journalisten und Behördenvertreter, die den Fall verfolgt haben, und versucht, nicht nur das Verbrechen zu rekonstruieren, sondern auch den Zirkus, der es umgab.
Mehr als ein True Crime ist der Dokumentarfilm ein Versuch, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Ein Versuch, den ohrenbetäubenden Lärm der Live-Berichterstattung zum Schweigen zu bringen und endlich die Stimme des Opfers zu hören.
Die Dokumentation „Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel“ (Originaltitel: Caso Eloá: Refém ao Vivo) startet am 12. November auf Netflix.