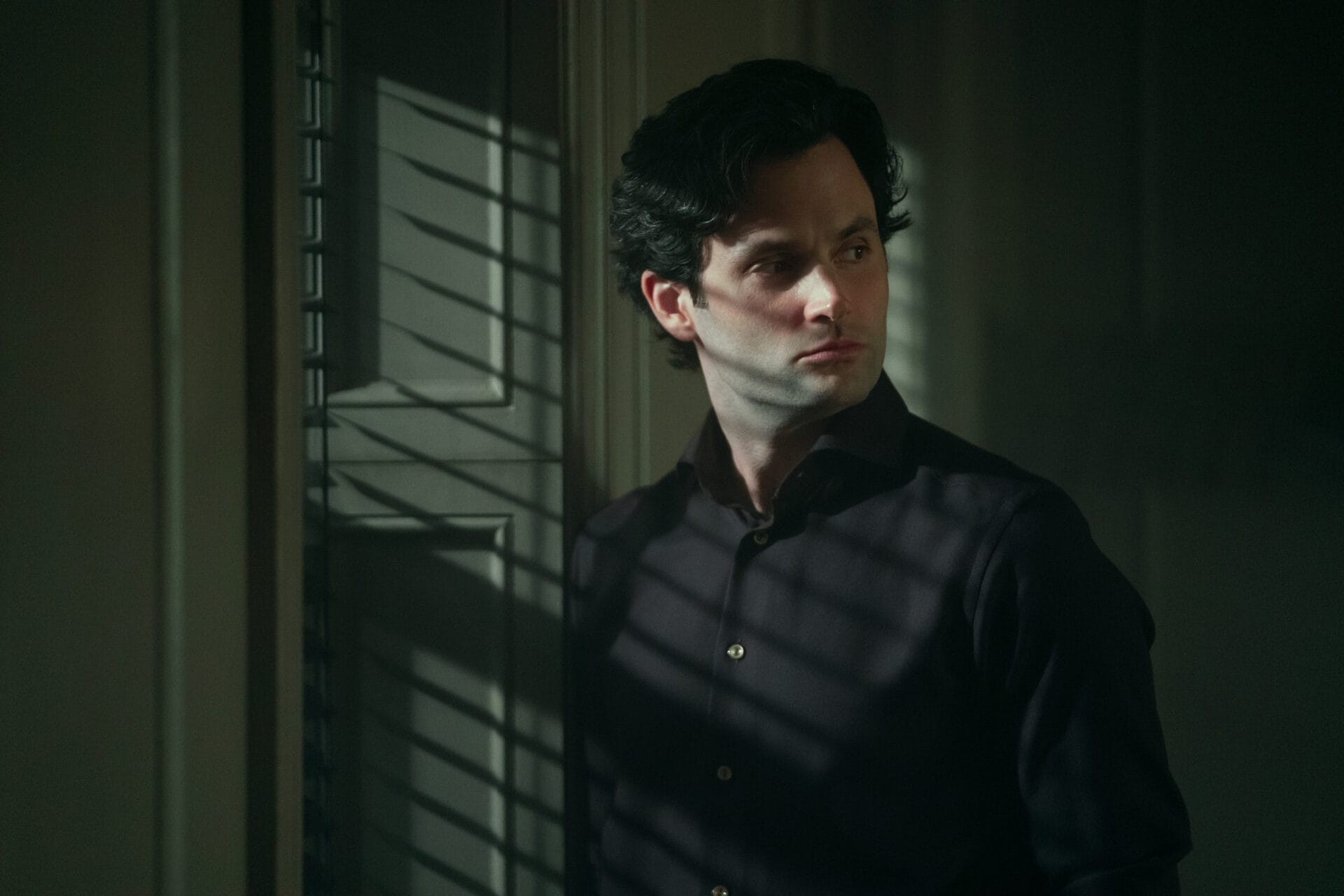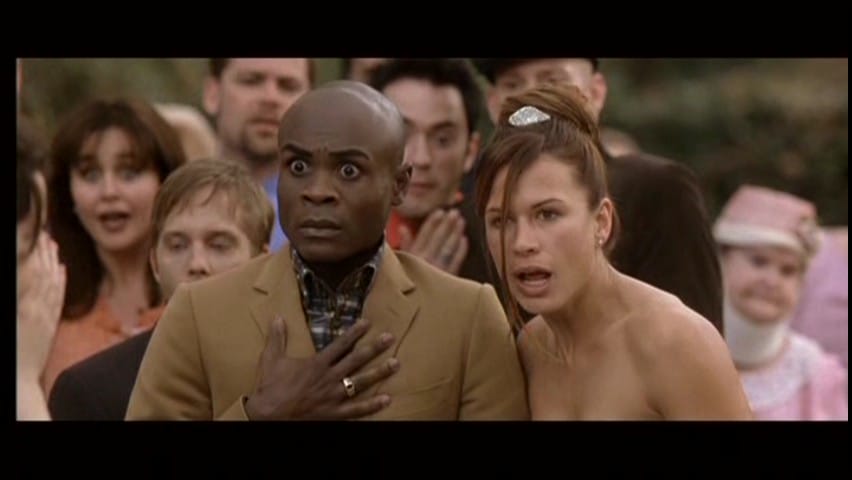Im großen Pantheon des modernen Kinos gibt es nur wenige Persönlichkeiten, die einen so einzigartigen und liebevoll gestalteten Platz einnehmen wie Guillermo del Toro. Er ist Filmemacher, Autor, Künstler – aber vor allem ist er ein Alchimist. Seit über drei Jahrzehnten praktiziert er eine einzigartige Form der kinematografischen Alchemie, indem er das, was manche als „niedere Materie“ bezeichnen würden – Monster, Geister, Insekten und die Insignien des Horrors – in erzählerisches Gold verwandelt. Sein Werk ist das Zeugnis eines tiefen und unerschütterlichen Glaubens: dass Monster die „Schutzheiligen der Unvollkommenheit“ sind und dass im Grotesken eine einzigartige und poetische Schönheit liegt.
Seine Karriere ist kein einfacher Aufstieg vom Low-Budget-Horror zum Hollywood-Prestige, sondern ein konsequentes, lebenslanges Projekt, ein kinematografisches Kuriositätenkabinett zu errichten. Jeder Film ist eine neue Schublade in diesem Kabinett, die eine akribisch gestaltete Welt offenbart, in der Märchen mit der brutalen Maschinerie der Geschichte kollidieren und in der die menschlichsten Charaktere oft Hörner, Kiemen oder Uhrwerkherzen haben. Diese unerschütterliche Vision hat ihn zu den höchsten Gipfeln der Branche geführt und ihm Oscars für die beste Regie und den besten Film für ein Werk über die Liebe einer stummen Frau zu einem Flussgott eingebracht, sowie einen weiteren für den besten Animationsfilm für eine Stop-Motion-Fabel über einen Holzjungen im faschistischen Italien. Guillermo del Toros Weg ist die Geschichte eines Regisseurs, der seine Vision nicht änderte, um die Anerkennung Hollywoods zu gewinnen, sondern Hollywood durch schiere Kunstfertigkeit und Überzeugung dazu brachte, seine tiefgründige, monströse Vision endlich wertzuschätzen.
Eine Kindheit, geschmiedet in Schatten und Glauben
Der Rohstoff für del Toros gesamte künstlerische Vision stammt aus den Straßen und Häusern seiner Heimatstadt Guadalajara in Mexiko, wo er am 9. Oktober 1964 geboren wurde. Seine Jugend war ein Schmelztiegel tiefgreifender und oft widersprüchlicher Einflüsse. Er wuchs in einem strengen, tiefkatholischen Haushalt auf, der von seiner Großmutter beherrscht wurde, einer Frau, deren Glaube sowohl eine Quelle reicher Ikonografie als auch tief sitzenden Schreckens war. Sie sah seine aufkeimende Faszination für Fantasy und Horror nicht als kreativen Funken, sondern als spirituelle Krankheit. Da sie seine Zeichnungen von Monstern und Dämonen missbilligte, unterzog sie den Jungen zwei Exorzismen und bespritzte ihn mit Weihwasser, um seine Seele zu reinigen. Als zusätzliche Buße legte sie ihm Kronkorken in die Schuhe, damit seine Füße bluteten – eine krasse, physische Manifestation religiöser Schuld.
Dieser morbide Katholizismus spiegelte sich in der ungefilterten Realität der Stadt wider. Del Toro hat von seiner frühen, wiederholten Konfrontation mit dem Tod gesprochen und bewahrt lebhafte Erinnerungen an echte Leichen in Leichenschauhäusern, Kirchenkatakomben und auf der Straße nach Unfällen oder Gewalttaten. Diese Umgebung, in der das Heilige und das Profane in einem ständigen, tiefgreifenden Dialog standen, formte einen Geist, der keine klare Grenze zwischen dem Realen und dem Fantastischen sah. Um zu entkommen, zog er sich in eine Fantasiewelt zurück und fand Trost nicht bei Heiligen, sondern bei Monstern.
Seine kreativen Impulse fanden ein Ventil, als er im Alter von etwa acht Jahren mit der Super-8-Kamera seines Vaters zu experimentieren begann. Seine ersten Filme, mit Spielzeugen aus Planet der Affen und anderen Haushaltsgegenständen, waren bereits von einer dunklen, komischen Sensibilität durchdrungen. Ein bemerkenswerter Kurzfilm handelte von einer „mörderischen Serienkartoffel“ mit Weltherrschaftsambitionen, die ihre Familie ermordete, bevor sie kurzerhand von einem Auto überfahren wurde. Diese frühen Arbeiten zeigen einen Geist, der bereits mit den Tropen des Horrors spielte und eine seltsame und wunderbare Kraft im Makabren fand. Der zentrale Konflikt in del Toros späterem Werk – der Zusammenprall zwischen starren, grausamen Institutionen und dem gefühlvollen, missverstandenen „Monster“ – war eine direkte Veräußerlichung dieser Kindheit. Er lehnte den Glauben seiner Großmutter nicht einfach ab; er eignete sich deren gotischen Pomp an und übertrug das Gefühl von Ehrfurcht und Schrecken auf eine neue, persönliche Mythologie seiner eigenen Schöpfung.
Die Lehrjahre des Handwerkers: Von Necropia zu Cronos
Del Toros Weg vom jugendlichen Hobbyisten zum professionellen Filmemacher basierte auf praktischer Handwerkskunst. Er schrieb sich an der Universität von Guadalajara für Filmwissenschaften ein, wo er sogar sein erstes Buch veröffentlichte, eine Biografie über Alfred Hitchcock. Seine entscheidendste Ausbildung erhielt er jedoch nicht im Hörsaal, sondern in einer Werkstatt. Er suchte den legendären Dick Smith auf, den Künstler hinter den bahnbrechenden Effekten von Der Exorzist, und lernte bei ihm Spezialeffekte und Make-up. Diese Mentorschaft war transformativ. Das nächste Jahrzehnt widmete sich del Toro dem Handwerk, arbeitete als Special-Effects-Make-up-Designer und gründete schließlich seine eigene Firma in Guadalajara, Necropia. In dieser Zeit verfeinerte er seine Fähigkeiten bei mexikanischen Fernsehsendungen wie Hora Marcada, wo er an der Seite zukünftiger Mitarbeiter wie Alfonso Cuarón und Emmanuel Lubezki arbeitete und das Guadalajara International Film Festival mitbegründete.
Dieses tiefe, taktile Verständnis davon, wie Filmmagie physisch geformt, modelliert und zum Leben erweckt wird, sollte das Fundament seines Regiestils werden und eine lebenslange Vorliebe für praktische Effekte begründen, die seinen fantastischen Schöpfungen ein greifbares, eindringliches Gewicht verleihen. Diese intensive Lehrzeit gipfelte 1993 in seinem Spielfilmdebüt Cronos. Der Film, der mit einem Budget von rund 2 Millionen Dollar finanziert wurde, das del Toro teilweise selbst aufbrachte, war der ultimative Ausdruck seines Weges als Handwerker. Es war ein Film, der auf seiner Expertise für praktische Effekte basierte und von ihr finanziert wurde. Cronos erzählt die Geschichte eines älteren Antiquitätenhändlers, der ein 400 Jahre altes, insektenähnliches Gerät entdeckt, das ewiges Leben gewährt, allerdings zum Preis eines vampirischen Blutdurstes. Der Film war eine vollendete Absichtserklärung und präsentierte der Welt del Toros charakteristische Motive: komplexe Uhrwerkmechanismen, insektoide Bilder, ein tragisches und sympathisches Monster und eine tiefe Quelle katholischer Symbolik. Er markierte auch seine erste Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Ron Perlman, der einen brutalen Amerikaner spielte, der nach dem Gerät suchte.
Cronos war in Mexiko eine Sensation und gewann bei den Ariel Awards neun Preise, darunter für den besten Film und die beste Regie. Er gewann anschließend den renommierten Preis der Internationalen Kritikerwoche bei den Filmfestspielen von Cannes und kündigte damit die Ankunft einer erstaunlich originellen Stimme im Weltkino an. In den Vereinigten Staaten war die Veröffentlichung jedoch begrenzt und er spielte nur 621.392 Dollar ein. Der Film war ein Liebling der Kritiker, aber kommerziell nur eine Randnotiz – ein Muster, das die nächste Phase seiner Karriere prägen sollte, als er sich ins Herz des Hollywood-Systems wagte.
Die Feuerprobe: Das Hollywood-Martyrium von Mimic
Nach dem internationalen Erfolg von Cronos wagte del Toro 1997 mit dem Science-Fiction-Horrorfilm Mimic – Angriff der Killerinsekten, produziert von Miramax‘ Genre-Label Dimension Films, seinen ersten Vorstoß in das amerikanische Studiosystem. Die Erfahrung sollte sich als traumatische Feuerprobe erweisen. Er geriet ständig mit den Produzenten Bob und Harvey Weinstein aneinander, die sich seiner Meinung nach in jeden Aspekt des Projekts einmischten. Das Studio stellte seine Entscheidungen bezüglich Handlung, Besetzung und Tonfall in Frage und forderte einen konventionelleren und „gruseligeren“ Film als den atmosphärischen Kreaturenfilm, den sich del Toro vorstellte. Das ursprüngliche Konzept mit geisterhaft weißen Insekten wurde zu riesigen, mutierten Kakerlaken geändert – ein Schritt, von dem del Toro befürchtete, er würde seinen Film zu „dem Film mit den Riesenkakerlaken“ machen.
Die kreativen Kämpfe wurden so intensiv, dass Harvey Weinstein Berichten zufolge das Set in Toronto stürmte, um del Toro Anweisungen zur Regie zu geben, und später versuchte, ihn feuern zu lassen – ein Vorhaben, das nur durch das Eingreifen der Hauptdarstellerin Mira Sorvino verhindert wurde. Del Toro hat die Dreharbeiten zu Mimic seither als eine der schlimmsten Erfahrungen seines Lebens bezeichnet, eine „schreckliche, schreckliche, schreckliche Erfahrung“, die er mit der Entführung seines eigenen Vaters verglich. Er distanzierte sich schließlich von der Kinofassung des Films, konnte aber 2011 einen Director’s Cut veröffentlichen, der einige seiner ursprünglichen Absichten wiederherstellte. Diese Tortur hätte ihn fast gänzlich vom amerikanischen Filmemachen abgebracht.
Jedoch hatte das berufliche Trauma von Mimic einen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluss auf sein Handwerk. Als Reaktion darauf, dass seine Arbeit vom Studio neu geschnitten und kontrolliert wurde, entwickelte del Toro bewusst einen spezifischen Regiestil als Form der kreativen Selbsterhaltung. Er begann, so zu filmen, dass ein einfacher Umschnitt erschwert wurde, indem er fließende, komplexe und oft lange Kamerabewegungen einsetzte, die sich durch das Set schlängeln. Dieser Stil der „schwebenden Kamera“, der heute als Markenzeichen seiner Kunst gefeiert wird, entstand als kalkulierte Überlebenstaktik. Es war eine Möglichkeit, die Kamera zu einer eigenständigen erzählerischen Figur zu machen und die narrative Logik so tief in die Bildsprache einer Einstellung einzubetten, dass sie im Schneideraum nicht einfach zerlegt werden konnte. Der Schmerz von Mimic schmiedete genau die Werkzeuge, mit denen er seine zukünftigen Meisterwerke bauen sollte.
Rückkehr zu den Wurzeln: Der spanische Gothic von The Devil’s Backbone
Nach seinem Hollywood-Martyrium zog sich del Toro strategisch und spirituell notwendig zurück. Er kehrte zu seinen Wurzeln zurück, gründete seine eigene Produktionsfirma, The Tequila Gang, und begann eine spanischsprachige Koproduktion zwischen Spanien und Mexiko. Das Ergebnis war The Devil’s Backbone (2001), eine zutiefst persönliche Gothic-Geistergeschichte, die sowohl als kreative Verjüngung als auch als thematische Blaupause für sein gefeiertstes Werk diente.
Der Film wurde vom legendären spanischen Regisseur Pedro Almodóvar und seinem Bruder Agustín über ihre Firma El Deseo produziert. Diese Partnerschaft erwies sich als das perfekte Gegenmittel zum Gift von Mimic. Del Toro wurde völlige kreative Freiheit gewährt, ein Konzept, das so absolut war, dass Pedro Almodóvar, als er um den Final Cut bat, aufrichtig verwirrt war und antwortete: „Aber natürlich, die Entscheidung liegt bei Ihnen!“. Diese geschützte Umgebung ermöglichte es del Toro, seine Stimme wiederzufinden und die Wunden seines vorherigen Films zu heilen. Er griff ein Drehbuch wieder auf, das er bereits vor Cronos geschrieben hatte, eine Geschichte, die 1939 während des letzten Jahres des Spanischen Bürgerkriegs spielt. Sie folgt einem Jungen, Carlos, der in ein verfluchtes Waisenhaus geschickt wird, das von republikanischen Loyalisten geleitet wird. Dort konfrontiert er nicht nur den Geist eines ermordeten Kindes, sondern auch die sehr menschlichen Übel von Gier und Gewalt, verkörpert durch den Hausmeister Jacinto. Der Film verbindet meisterhaft übernatürlichen Horror mit historischer Tragödie und etabliert den Spanischen Bürgerkrieg als das, was del Toro später einen „Geister-Motor“ nennen sollte – ein historisches Trauma, so tief, dass seine Gespenster die Gegenwart weiterhin heimsuchen.
The Devil’s Backbone wurde von der Kritik als Meisterwerk der Stimmung und Metapher gefeiert. Wichtiger noch für del Toro war es die Bestätigung, dass seine kompromisslose Vision zu kraftvollem, resonanzstarkem Kino führen konnte. Er hat den Film als den „Bruderfilm“ zu Pans Labyrinth beschrieben, ein maskulineres Gegenstück zur femininen Energie seines späteren Werks. Die kreative Erfüllung und der kritische Erfolg von The Devil’s Backbone waren die wesentliche künstlerische Therapiesitzung, die nicht nur sein Selbstvertrauen wiederherstellte, sondern auch die grundlegenden Themen und den historischen Hintergrund für das Magnum Opus legte, das noch kommen sollte.
Die Eroberung des Mainstreams: Blade II und die Hellboy-Saga
Gestärkt durch den kreativen Triumph von The Devil’s Backbone kehrte del Toro nach Hollywood zurück, aber diesmal zu seinen eigenen Bedingungen. Er übernahm die Regie der Vampir-Superhelden-Fortsetzung Blade II (2002), ein Projekt, das es ihm ermöglichte, seine gotische, monströse Ästhetik mit hochoktaniger Blockbuster-Action zu verbinden. Er war des romantischen Tropus der „gequälten viktorianischen Helden“ überdrüssig und entschlossen, Vampire wieder furchteinflößend zu machen. Der Film war ein durchschlagender Erfolg, spielte 155 Millionen Dollar ein und bewies, dass seine einzigartigen Empfindungen innerhalb einer Mainstream-Franchise gedeihen konnten. Er brachte seine charakteristische Liebe zu praktischen Effekten, aufwendigem Kreaturendesign – wie den furchterregenden „Reapers“ mit ihren gespaltenen Kiefern – und stimmungsvoller, atmosphärischer Beleuchtung in die Welt der Comicverfilmungen ein und schuf das, was viele Fans als den Höhepunkt der Trilogie betrachten.
Dieser Erfolg verschaffte ihm den nötigen Einfluss in der Branche, um ein Projekt zu verfolgen, das er seit Jahren gehegt hatte: eine Adaption von Mike Mignolas Comic Hellboy. Der Weg, den schlagfertigen, rothäutigen Dämon auf die Leinwand zu bringen, war mühsam und von del Toros unerschütterlicher Loyalität und künstlerischer Integrität geprägt. Sieben Jahre lang kämpfte er mit Studios, die dem Projekt und vor allem seiner Wahl für die Hauptrolle skeptisch gegenüberstanden. Del Toro bestand darauf, dass nur ein Schauspieler die Seele der Figur verkörpern könne: sein Freund und häufiger Mitarbeiter, Ron Perlman. Er weigerte sich, den Film mit jemand anderem zu drehen, und war bereit, das gesamte Projekt zu opfern, anstatt bei dem Kompromisse einzugehen, was er als das Herzstück des Films empfand.
Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Hellboy wurde 2004 veröffentlicht, gefolgt von der noch fantastischeren Fortsetzung Hellboy – Die goldene Armee im Jahr 2008. Die Filme sind ein lebendiges Schaufenster für del Toros Leidenschaften. Sie sind gefüllt mit atemberaubenden praktischen Effekten und Kreaturendesigns, von denen viele direkt aus seinen persönlichen Notizbüchern stammten. Er ging diese Franchise-Filme nicht als Auftragsregisseur an, sondern mit derselben Autorenleidenschaft, die er auch in seine unabhängigen Arbeiten einbrachte. Er balancierte die explosive Action mit echtem Pathos und charakterbasiertem Humor aus und vermenschlichte seinen monströsen Helden und seine gefundene Familie von „Freaks“. Damit verwischte del Toro effektiv die Grenze zwischen dem Arthouse-Kino und dem Multiplex und demonstrierte, dass für ihn eine Geschichte über ein sympathisches Monster ein lohnendes Unterfangen war, unabhängig vom Budget.
Das Meisterwerk: Im Inneren von Pans Labyrinth
Im Jahr 2006 veröffentlichte Guillermo del Toro den Film, der seine Karriere definieren und seinen Status als einer der weltweit führenden Kinovisionäre festigen sollte: Pans Labyrinth (El laberinto del fauno). Als internationale Koproduktion zwischen Spanien und Mexiko war es ein so persönliches Projekt, dass del Toro sein eigenes Gehalt investierte, um dessen Fertigstellung zu gewährleisten. Der Film ist die ultimative Synthese aller Themen, Einflüsse und Obsessionen, die sein Leben und seine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt geprägt hatten.
Die Geschichte, die aus zwanzig Jahren Ideen, Zeichnungen und Handlungsfragmenten aus seinen akribisch geführten Notizbüchern entstand, spielt 1944, fünf Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg. Sie folgt einem jungen Mädchen namens Ofelia, das mit ihrer schwangeren Mutter zu einem ländlichen Militärposten reist, der von ihrem sadistischen neuen Stiefvater, dem falangistischen Hauptmann Vidal, kommandiert wird. Um der brutalen Realität ihres neuen Lebens zu entfliehen, entdeckt Ofelia ein altes Labyrinth und einen geheimnisvollen Faun, der ihr erzählt, sie sei eine lange verschollene Prinzessin der Unterwelt. Um ihr Königreich zurückzuerobern, muss sie drei gefährliche Aufgaben erfüllen.
Pans Labyrinth ist eine meisterhafte und herzzerreißende Mischung aus einem düsteren Märchen im Stil der Gebrüder Grimm und der unerbittlichen Brutalität des franquistischen Spaniens der Nachkriegszeit. Die Fantasiewelt ist keine einfache Flucht vor der Realität, sondern vielmehr eine metaphorische Linse, durch die Ofelia deren Schrecken verarbeitet und sich ihnen stellt. Die Themen Wahl und Ungehorsam sind zentral; Ofelia wird ständig auf die Probe gestellt und gezwungen, zwischen blindem Gehorsam gegenüber autoritären Figuren wie Vidal und dem Faun und ihrem eigenen angeborenen moralischen Kompass zu wählen. Die furchterregendste Schöpfung des Films, der blasse Mann, ein kinderfressendes Wesen, ist eine direkte Allegorie auf die institutionellen Übel des Faschismus und der mitschuldigen katholischen Kirche.
Der Film feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2006, wo er mit 22-minütigen stehenden Ovationen bedacht wurde, einer der längsten in der Geschichte des Festivals. Er wurde zu einem globalen Phänomen, spielte über 83 Millionen Dollar bei einem bescheidenen Budget von 19 Millionen Dollar ein und erntete weitreichendes Kritikerlob. Er erhielt sechs Oscar-Nominierungen, darunter für das beste Originaldrehbuch für del Toro, und gewann drei Oscars für Kamera, Szenenbild und Make-up. Der Film war die perfekte Destillation seiner gesamten künstlerischen Identität, das Werk, auf das seine ganze Karriere hingearbeitet hatte, und er verschaffte ihm immenses kreatives Kapital für all seine zukünftigen Unternehmungen.
Der Auteur als Produzent und Kollaborateur
Nach dem monumentalen Erfolg von Pans Labyrinth erweiterte sich del Toros Einfluss weit über seine eigene Regiearbeit hinaus. Er festigte seine Rolle als zentrale, schöpferische Kraft in der modernen Fantasy-Erzählung und nutzte seinen neu gewonnenen Einfluss, um andere Filmemacher zu fördern und sein kreatives Universum auf mehreren Plattformen zu erweitern. Seine Arbeit als Produzent ist kein Nebenjob, sondern eine direkte Erweiterung seines Weltenbau-Impulses. Da er nicht jede Geschichte, die seine Fantasie beflügelt, persönlich inszenieren kann – wie sein berühmtes, nie realisiertes Herzensprojekt, eine Adaption von H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns – nutzt er seinen Einfluss, um thematisch verwandte Welten zum Leben zu erwecken.
Er fungierte als Produzent und Mentor bei gefeierten spanischsprachigen Horrorfilmen wie J.A. Bayonas Das Waisenhaus (2007) und Andy Muschiettis Mama (2013) und förderte neue Talente in dem von ihm geliebten Genre. Er wurde auch zu einer wichtigen kreativen Kraft in der Animation und war ausführender Produzent bei DreamWorks-Animationsfilmen wie Der gestiefelte Kater (2011), Die Hüter des Lichts (2012) und den Kung Fu Panda-Fortsetzungen. Seine Reichweite erstreckte sich auch auf Blockbuster-Franchises und das Fernsehen. Nachdem er ursprünglich für die Regie der Verfilmung von Der Hobbit vorgesehen war, trat er schließlich vom Regiestuhl zurück, blieb aber als Co-Autor für alle drei Filme von Peter Jacksons Trilogie genannt und prägte so die Erzählung von Mittelerde. Er wagte sich ins Fernsehen als Mitschöpfer und ausführender Produzent der FX-Serie The Strain (2014-2017), die auf der von ihm gemeinsam mit Chuck Hogan verfassten Vampir-Roman-Trilogie basiert. Für Netflix schuf er die umfangreiche und beliebte Animations-Franchise Die Sagen von Arcadia, die die Serien Trolljäger, 3 von oben und Die Zauberer umfasst. Durch diese vielfältigen Projekte kuratiert del Toro effektiv ein größeres, gemeinsames Universum der Dark Fantasy und nutzt seinen Namen und seine Ressourcen, um sein „Kuriositätenkabinett“ in einem weitaus größeren Maßstab zu errichten, als er es allein könnte.
Eine unkonventionelle Liebesgeschichte: Die Form eines Oscars
Im Jahr 2017 inszenierte Guillermo del Toro den Film, der ihm die höchsten Auszeichnungen der Branche einbringen sollte: Shape of Water – Das Flüstern des Wassers. Die Entstehung des Films geht auf eine Kindheitserinnerung zurück – das Anschauen von Der Schrecken vom Amazonas und der Wunsch, dass das Monster und die Hauptdarstellerin in ihrer Romanze erfolgreich gewesen wären. Jahrzehnte später verwirklichte er diesen Wunsch in einem Märchen aus der Zeit des Kalten Krieges, das zu seinem meistgefeierten Werk wurde.
Die Geschichte spielt 1962 in Baltimore und handelt von Elisa Esposito, einer stummen Reinigungskraft in einem geheimen Regierungslabor. Ihr Leben in stiller Isolation wird verwandelt, als sie das sensibelste Gut des Labors entdeckt: eine amphibische, menschenähnliche Kreatur, die im Amazonas gefangen wurde. Während sie eine stille Verbindung zu der Kreatur aufbaut, deckt sie den Plan eines sadistischen Regierungsagenten auf, sie zu vivisezieren. Der Film ist eine wunderschöne, melancholische Ode an Außenseiter, wobei Elisas gefundene Familie – ihr im Verborgenen lebender schwuler Nachbar und ihre afroamerikanische Kollegin – die marginalisierten Stimmen der Ära repräsentieren. Mit einem relativ bescheidenen Budget von 19,5 Millionen Dollar gedreht, ist Shape of Water eine Meisterklasse in Atmosphäre und Emotion, die ihre 1962er Kulisse als „ein Märchen für unruhige Zeiten“ nutzt, um die sozialen und politischen Ängste der Gegenwart zu kommentieren.
Der Film feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig, wo er den Goldenen Löwen gewann, und wurde zu einem Kraftpaket der Kritiker und der Preisverleihungssaison. Seine triumphale Nacht kam bei der 90. Oscar-Verleihung. Der Film, der mit dreizehn Nominierungen an der Spitze stand, gewann vier Oscars, darunter für das beste Szenenbild, die beste Filmmusik, die beste Regie für del Toro und den begehrten Preis für den besten Film. Es war ein wegweisender Moment. Jahrzehntelang waren Genrefilme von den großen Preisverleihungen weitgehend auf technische Kategorien beschränkt worden. Mit diesem Sieg umarmte die Academy voll und ganz del Toros lebenslanges Argument: dass eine Geschichte über ein Monster und eine Romanze zwischen einer Frau und einem „Fischmann“ genauso tiefgründig, künstlerisch und der höchsten Ehre der Branche würdig sein kann wie jedes traditionelle Drama. Die „niedere Materie“, die er so schätzte, war in den Augen des Establishments alchemistisch in Kinogold verwandelt worden.
Eine sich entwickelnde Vision: Noir, Animation und die Zukunft
In den Jahren nach seinem Oscar-Triumph hat sich del Toro als Künstler weiterentwickelt, neue Genres erkundet und sich gleichzeitig auf seine ältesten Leidenschaften konzentriert. Im Jahr 2021 veröffentlichte er Nightmare Alley, eine bedeutende Abweichung, da es sein erster Spielfilm ohne übernatürliche Elemente war. Als aufwendige und düstere Adaption von William Lindsay Greshams Roman von 1946 ist der Film eine reine, dunkle Erforschung menschlicher Ambitionen und Verderbtheit und demonstriert seine Meisterschaft im klassischen Film Noir. Mit seinem atemberaubenden Szenenbild und einer Tour-de-Force-Leistung von Bradley Cooper erhielt der Film vier Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film, was bewies, dass seine künstlerische Führung über das Reich des Fantastischen hinausging.
Darauf folgte ein Projekt, das über ein Jahrzehnt gereift war: Guillermo del Toros Pinocchio (2022). Er kehrte zu seiner ersten Liebe, der Stop-Motion-Animation, zurück und interpretierte die klassische Geschichte nicht als Kindergeschichte neu, sondern als eine düstere, tiefgründige Fabel über Leben, Tod und Ungehorsam vor dem Hintergrund von Mussolinis faschistischem Italien. Der Film war ein technisches und emotionales Wunderwerk, gefeiert für seine handwerkliche Schönheit und seine reifen, antifaschistischen Themen. Er räumte bei den Preisverleihungen ab und gipfelte in einem weiteren Oscar-Sieg für del Toro, diesmal für den besten Animationsfilm.
Dieser Sieg hat einen neuen Weg für den Regisseur gefestigt. Er hat erklärt, dass er nach einigen weiteren Realfilmen den Rest seiner Karriere hauptsächlich der Animation widmen möchte, einem Medium, das er als die „reinste Kunstform“ und diejenige mit der größten kreativen Kontrolle betrachtet. Für einen Filmemacher, der von akribischem Weltenbau besessen ist – ein Wunsch, der aus seinen Kindheits-Super-8-Filmen geboren und durch das Trauma der Studio-Einmischung gefestigt wurde – stellt Stop-Motion die letzte Grenze dar. Es ist das eine Medium, in dem die Hand des Regisseurs buchstäblich in jeder einzelnen Einstellung steckt, ein direkter und kompromissloser Ausdruck seines Willens. Dieser Schwenk schließt den Kreis seiner Reise, vom Jungen, der seine Spielzeuge in Guadalajara animierte, zum Meister, der seine Puppen auf einer globalen Bühne animiert.
Eine lebenslange Leidenschaft wiederbelebt: Frankenstein
Im Jahr 2025 wird del Toro Frankenstein veröffentlichen, ein Projekt, das den Höhepunkt einer lebenslangen künstlerischen Besessenheit darstellt. Für del Toro ist die Geschichte nicht nur ein Klassiker des Genres; sie ist eine persönliche Religion. Er hat davon gesprochen, als Kind Boris Karloffs Monster gesehen und zum ersten Mal verstanden zu haben, „wie ein Heiliger oder ein Messias aussah“. Diese zutiefst persönliche Verbindung hat seinen Wunsch, Mary Shelleys Roman zu adaptieren, jahrzehntelang beflügelt, während er auf die richtigen Bedingungen wartete, um eine Version zu schaffen, die die gesamte Welt der Geschichte im richtigen Maßstab rekonstruieren könnte.
Seine Vision für den Film ist nicht die eines konventionellen Horrorfilms, sondern vielmehr eine „unglaublich emotionale Geschichte“. Er möchte das Gefühl wiedergeben, den Roman zum ersten Mal zu lesen, bevor seine Charaktere zu kulturellen Karikaturen wurden. Die Erzählung wird sich auf die komplexe Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung konzentrieren und Themen wie Vaterschaft und Sohnschaft erkunden, die tief in del Toros eigenem Leben verwurzelt sind. Die Hauptrollen spielen Oscar Isaac als der brillante und egozentrische Wissenschaftler Victor Frankenstein und Jacob Elordi als seine tragische Schöpfung. Zur Besetzung gehören außerdem Mia Goth, Christoph Waltz und Charles Dance. Der Film soll am 17. Oktober 2025 in begrenztem Umfang in die Kinos kommen, bevor er am 7. November 2025 weltweit auf Netflix gestreamt wird. Del Toro hat den Film als das Ende einer Ära für ihn beschrieben, eine große Synthese der ästhetischen, rhythmischen und empathischen Anliegen, die seine Arbeit von Cronos bis heute definiert haben.
Der Schutzheilige der Unvollkommenheit
Die Karriere von Guillermo del Toro ist ein Zeugnis für die Kraft einer einzigartigen, zutiefst persönlichen Vision. Sein Weg von einem monsterbesessenen Jungen in Guadalajara zu einem gefeierten Meister moderner Fabeln wurde von einem unerschütterlichen Bekenntnis zu seinen Grundüberzeugungen geprägt. Er hat sich konsequent für die Ausgestoßenen, die „Anderen“ und die Unvollkommenen eingesetzt und in ihnen eine gefühlvolle Schönheit gefunden, die unsere eigene fehlerhafte Menschlichkeit widerspiegelt. Sein überzeugter Antiautoritarismus, ob gegen die Maschinerie des Faschismus oder das Dogma der Kirche gerichtet, zieht sich als starke Unterströmung durch sein gesamtes Werk. Er ist ein Auteur im wahrsten Sinne des Wortes, dessen thematische Anliegen und unverwechselbare Bildsprache sofort erkennbar sind. Seine Filme sind düster und doch hoffnungsvoll, grotesk und doch poetisch, und sie basieren auf dem tiefen Verständnis, dass Märchen keine Flucht vor der Realität sind, sondern ein wesentliches Werkzeug, um durch ihre dunkelsten Ecken zu navigieren.
Guillermo del Toro erschafft nicht nur Monster; er versteht sie, er liebt sie, und er sieht sie als die Schutzheiligen einer Welt, die es dringend nötig hat, ihre Unvollkommenheiten anzunehmen. Damit hält er uns einen wunderschön seltsamen und zutiefst einfühlsamen Spiegel vor, der das Monströse und Magische in uns allen reflektiert.